
Digitale Langzeitarchivierung – Was ist das eigentlich?
Wie der Name schon sagt, geht es bei der digitalen Langzeitarchivierung darum, dass digitale Daten langfristig erhalten werden.
Im privaten Umfeld handelt es sich dabei häufig um Erinnerungen in Form von Fotos und Videos oder auch Musik.
Im Wissenschaftlichen Kontext sind alle Forschungsdaten und Arbeitsprozesse relevant, die digital dokumentiert sind.
Wo liegen die Probleme?
Wir kennen es alle: der Computer schlägt und so lange das Update auf die nächste Stufe des Betriebssystems vor, bis wir es nicht mehr wegklicken können und es zwangsläufig herunterladen müssen. Nach dem Update kann es passieren, dass sich auf einmal alte Dateien nicht mehr öffnen lassen, da das neue Betriebssysteme das Dateiformat nicht mehr unterstützt. Danach ist es dann notwendig, die Datei aufwendig umzuwandeln, damit der Zugriff wieder möglich ist. Genauso sieht es bei CD-ROMS aus. Was vor gut 30 Jahren noch der neuste Stand der Technik war, ist heute vollkommen überholt und häufig scheitert es schon daran, dass die meisten Computer kein CD-Laufwerk mehr haben. Weiterhin werden viele Datenträger im Laufe der Zeit beschädigt oder sind schlicht nicht mehr lesbar.
Die technischen Möglichkeiten der Technik verändern sich so schnell, dass das Hauptproblem der digitalen Langzeitarchivierung darin liegt, dass alle digitalen Inhalte möglichst zugänglich und abrufbar bleiben.
Private digitale Langzeitarchivierung
Die Seite meindigitalesArchiv des Kompetenznetzwerk nestor ist einer der besten Anlaufpunkte, um sich darüber zu informieren, wie die eigenen privaten Daten dauerhaft gesichert werden können.
Anhand von fiktiven Fallbeispielen werden verschiedenste Situationen geschildert, in denen es notwendig sein kann, die eigenen digitalen Daten zu ordnen und speichern. Das fängt beim simplen speichern von Bildern und der Übertragung von Smartphone-Inhalten an, geht aber auch weiter über Familienforschung und die Regelung von digitalen Nachlässen.

Wissenschaftliche digitale Langzeitarchivierung
Im Wissenschaftlichen Kontext, wenn es um Forschungsdaten geht, gibt es zwei Hauptstragtegien, wie die Daten erhalten werden: Migration und Emulation.
Die Migration beschriebt die Übertragung von Daten in die jeweils aktuellen Dateiformate umgewandelt und auf aktuelle Speichermedien übertragen werden. Dieser Prozess ist zeitaufwendig und und fehleranfällig, da auch alle Metadaten korrekt übertragen werden müssen, denn ohne den Kontext der Metadaten werden die Inhaltsdaten nahezu wertlos.
Bei der Emulation werden veraltete Hard- und / oder Softwareumgebungen in einem modernen System simuliert, sodass alte Programme und Dateien weiterhin verwendet werden können, ohne dass sie übertragen werden müssen.
Fazit
Die digitale Langzeitarchivierung ist deshalb so wichtig, weil sich der Stand der Technik kontinuierlich weiterentwickelt. Daten, die heute problemlos zugänglich sind, können in einigen Jahren unlesbar sein. Davon betroffen sind sowohl private Erinnerungen in digitaler Form, als auch wissenschaftliche Forschungsdaten.
Letztlich ist es notwendig, eine Archivierungsstrategie zu haben, um digitale Inhalte dauerhaft zugänglich zu halten und den drohenden Datenverlust zu vermeiden.
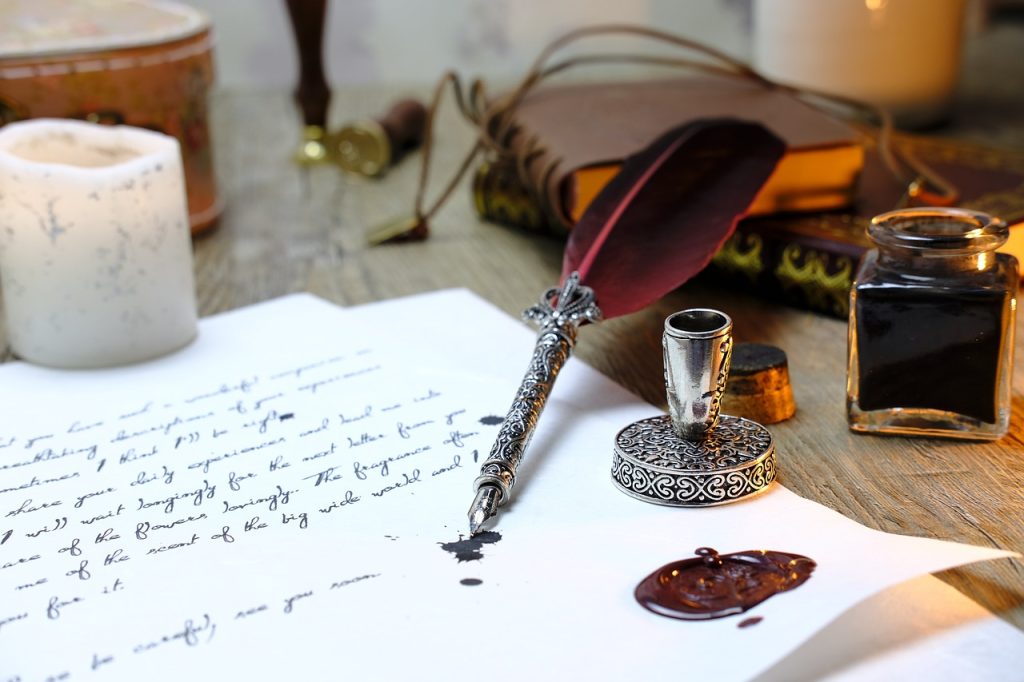
„Der Wert mancher Sache besteht darin, dass wir sie verloren haben.“
– Otto Weiß , Wiener Musiker und Feuilletonist
Quellen
Kompetenznetzwerk nestor
meindigitalesArchiv.de
https://www.aphorismen.de/zitat/192599
https://open.spotify.com/show/14BEfgbOu1HN28odE0ur1v
https://forschungsdaten.info/themen/veroeffentlichen-und-archivieren/langzeitarchivierung/

