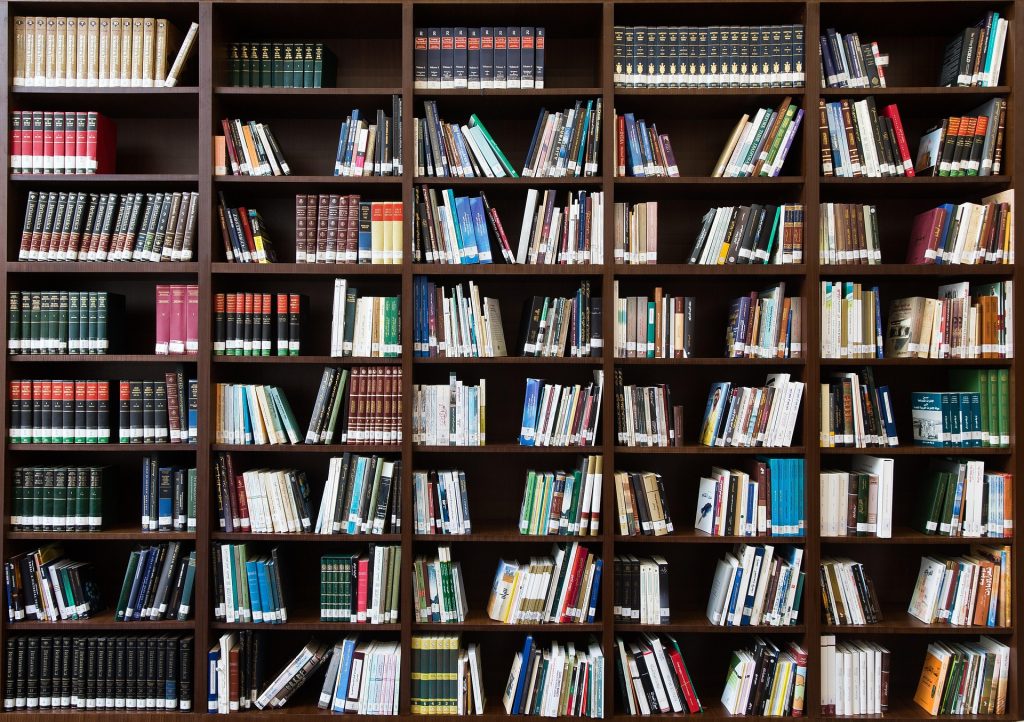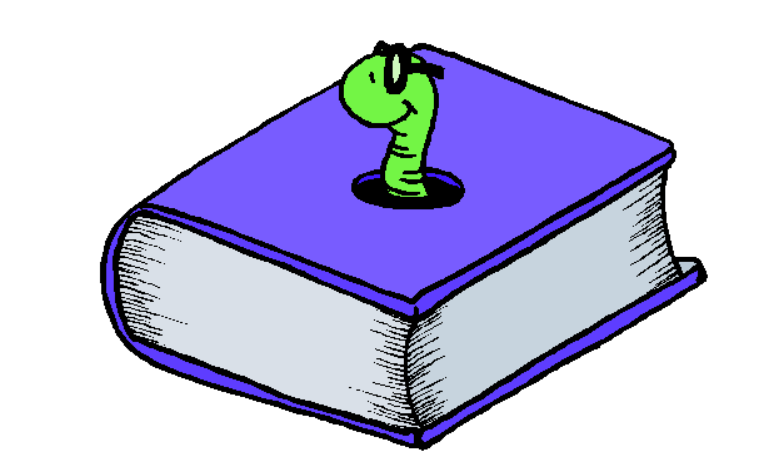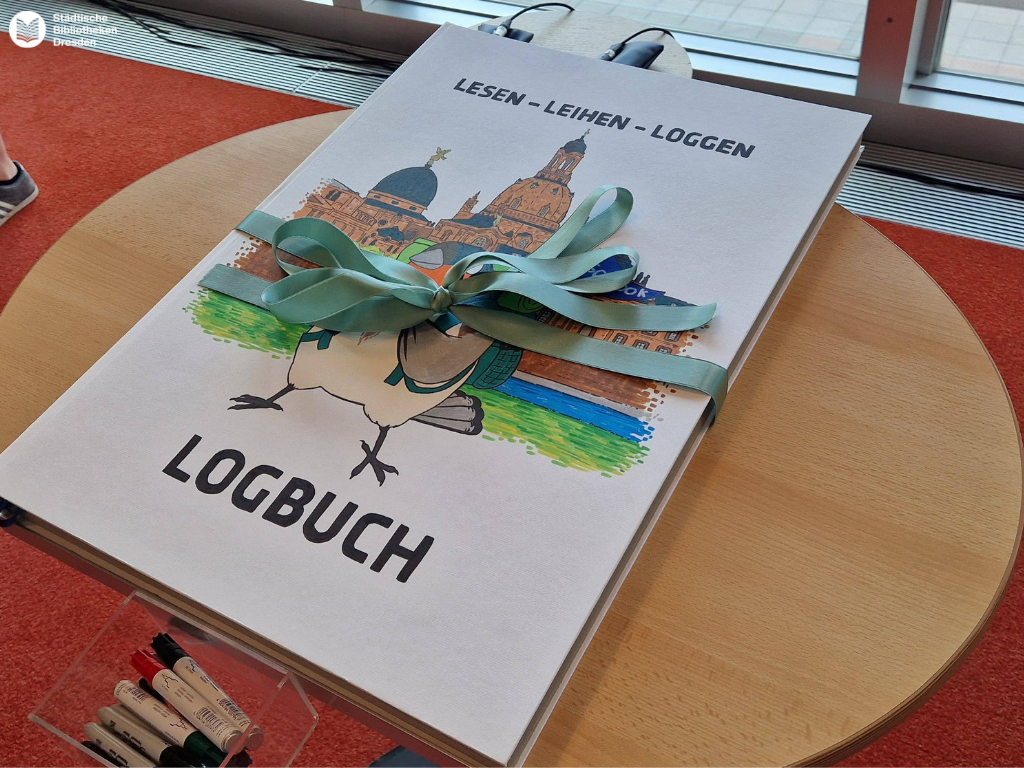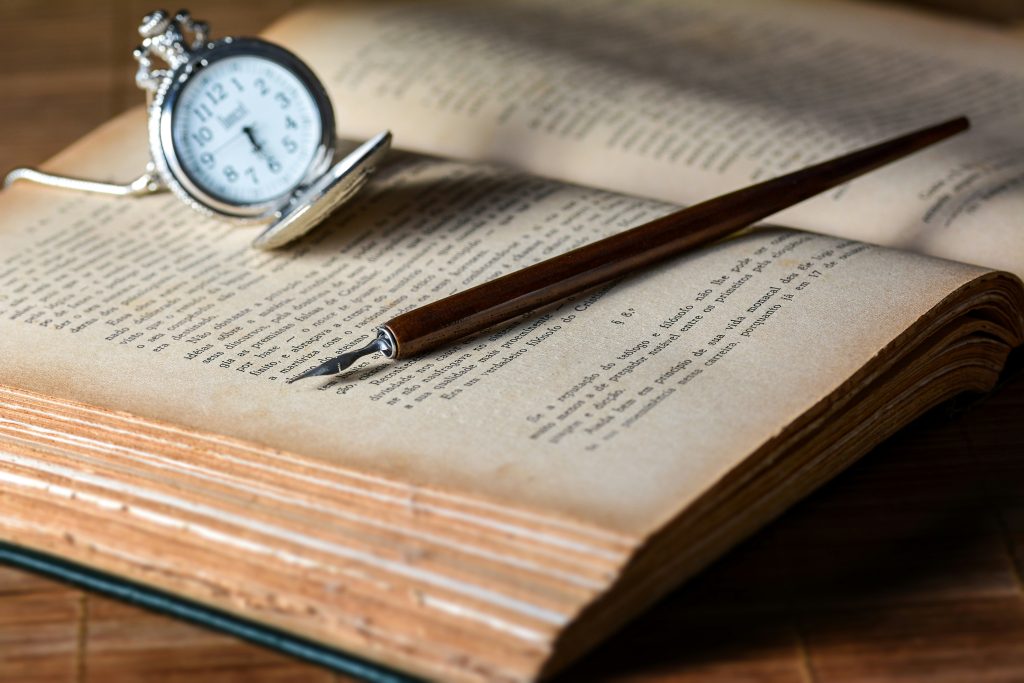
Woher kommen unsere Kulturgüter und wie gelangen sie in die öffentlichen Sammlungen? Wem haben sie vielleicht vorher gehört? Und was geschieht mit Werken, die ihren Eigentümer*innen während der NS-Zeit unter Zwang entzogen wurden? Auch viele Bibliotheken beschäftigen sich mit diesen Fragen. Mit Hilfe der Provenienzforschung untersuchen sie darum die Herkunft von Medienwerken und identifizieren NS-Raubgut in den eigenen Beständen.
Der folgende Beitrag bietet einen Einstieg in die Thematik und gibt Einblicke in die Grundlagen der Provenienzforschung.
Inhalt
- Was ist Provenienzforschung?
- Was ist NS-Raubgut?
- Wie kann NS-Raubgut in Bibliotheken identifiziert werden?
- Grundlagen für die Provenienzforschung und Restitution
- Informatives zum Thema Provenienzforschung
- Weiterführende Informationen und Literatur
Was ist Provenienzforschung?
Als „Provenienz“ wird im musealen, archivarischen und bibliothekarischen Kontext die Herkunft von Sammlungsobjekten, Archivalien oder Medienwerken bezeichnet. Der Begriff leitet sich vom lateinischen Wort „provenire“ ab, was so viel wie „herkommen“ bedeutet. Die Provenienzforschung befasst sich dabei mit der wissenschaftlichen Erforschung der Herkunftsgeschichte sowie der wechselnden Besitzverhältnisse einzelner Kulturgüter, Objekte und Sammlungen. Sie prüft zudem faire und gerechte Lösungen sowie eine mögliche Rückgabe an die rechtmäßigen Eigentümer*innen oder ihre Erb*innen.
Was ist NS-Raubgut?
NS-Raubgut bezeichnet Objekte, die der nationalsozialistische Staat politisch, rassistisch oder religiös verfolgten Personen und Institutionen entzog und somit ihren rechtmäßigen Eigentümer*innen raubte. Dieser systematische Raub durch die NS-Behörden war ein zentraler Bestandteil der Verfolgung und des staatlichen Terrors. Betroffen waren unter anderem Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma, religiöse und ethnische Minderheiten, politische Gegner*innen, Parteien, Gewerkschaften, Künstler*innen, Gelehrte und Homosexuelle. Die Enteignungen und gewaltsamen Beschlagnahmungen erstreckten sich sowohl auf Bürger*innen des Deutschen Reiches als auch der besetzten Gebiete.
Zu NS-Raubgut zählen ebenfalls Objekte, die Verfolgte unter Zwang oder großem Druck verkaufen mussten, etwa um eine Flucht ins Ausland zu finanzieren. Solche Verkäufe erfolgten häufig weit unter dem eigentlichen Wert der Objekte.
Welche Rolle spielten Bibliotheken bei der Verteilung von NS-Raubgut?
Bibliotheken spielten eine zentrale Rolle bei der Verwertung geraubter Bücher. So dienten sie unter anderem als zentrale Sammelstellen für beschlagnahmte Literatur und erwarben diese zum Teil selbst, um ihre eigenen Bestände zu ergänzen und Lücken zu füllen. Darüber hinaus berieten sie mit ihrer bibliografischen Expertise unter anderem bei der Bewertung und Verteilung geraubter Buchbestände. Die Reichstauschstelle im Reichsministerium des Innern koordinierte die Verteilung geraubter Bücher an Bibliotheken im gesamten Deutschen Reich. Insgesamt wurden dadurch Millionen von Büchern im gesamten Reichsgebiet verstreut.
Die Folgen dieses Kulturgutraubs sind bis heute spürbar und betreffen sowohl Bibliotheken, die bereits zur NS-Zeit existierten, als auch nach 1945 neu gegründete Bibliotheken. Viele dieser Bestände gelangen noch immer durch Schenkungen, Nachlässe oder Käufe aus Antiquariaten in öffentliche und private Bestände. Die Aufarbeitung und Restitution dieser Kulturgüter bleibt daher eine andauernde Aufgabe.
Wie kann NS-Raubgut in Bibliotheken identifiziert werden?
Um zu recherchieren, ob sich geraubte Objekte in der eigenen bibliothekarischen Sammlung befinden, gibt es verschiedene Ausgangspunkte. Für den Kontext des NS-Raubguts sind Kulturgüter und Medien zu prüfen, die vor 1945/46 entstanden bzw. erschienen sind und die nach 1933 in die Sammlung gelangt sind. Zum einen können bestimmte Provenienzmerkmale in den Büchern selbst enthalten sein, zum Beispiel Besitzerstempel, eingeklebte Exlibris und Etiketten sowie handschriftliche Eintragungen, wie Namen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, diese Art von Beständen über sogenannte „Zugangsbücher“ zu ermitteln.
Wie sehen Zugangsbücher aus?
Einige Einrichtungen (darunter auch Bibliotheken) bieten die Möglichkeit über ihren Online-Katalog oder eine Datenbank, digitalisierte Zugangsbücher einzusehen.
Zum Beispiel:
Gibt es in den Zugangsbüchern Auffälligkeiten bei den Herkunftsvermerken bezüglich dessen, wie die Bücher in die Bibliothek gelangt sind, werden die Exemplare im nächsten Schritt anhand von Autopsie überprüft. Das heißt, die entsprechenden Bücher werden in die Hand genommen und auf mögliche, enthaltene Hinweise auf die Vorbesitzer*innen untersucht.
Davon ausgehend werden anschließende, weiterführende Recherchen zu den Vorbesitzer*innen und deren Verfolgungsschicksalen unternommen, zum Beispiel mit Hilfe von Datenbanken, in Archiven und durch das Heranziehen von Sekundärliteratur. Ergeben die Nachforschungen, dass es sich tatsächlich um NS-Raubgut handelt, wird versucht, die ursprünglichen Eigentümer*innen bzw. deren Erb*innen ausfindig zu machen und gemeinsam faire und gerechte Lösungen für die Rückgabe bzw. den Verbleib des Raubgutes zu finden.
Grundlagen für die Provenienzforschung und Restitution
Die Washingtoner Erklärung
Die Grundlage für die Provenienzforschung bildet die sogenannte „Washingtoner Erklärung“, welche im Jahr 1998 auf der Washingtoner Konferenz über Vermögenswerte aus der Zeit des Holocaust verabschiedet wurde . Mit ihrer Unterzeichnung verpflichtete sich die Bundesrepublik Deutschland, NS-verfolgungsbedingt entzogene Kulturgüter in öffentlichen Sammlungen zu identifizieren und zusammen mit den früheren Eigentümer*innen oder ihren Erb*innen gerechte und faire Lösungen zu ermitteln bzw. eine Rückgabe zu ermöglichen.
Was sind gerechte und faire Lösungen?
Die Gemeinsame Erklärung
Um die Verpflichtung der Washingtoner Erklärung umsetzen zu können, verabschiedeten der Bund zusammen mit den Bundesländern und den kommunalen Spitzenverbänden im Dezember 1999 die „Gemeinsame Erklärung“ zur Auffindung und zur Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgutes. Darin erklärten sie sich zur Auffindung und Restitution von NS-Raubgut bereit und sicherten Ihre Unterstützung zu.
Handreichung
Zur Unterstützung bei der Umsetzung der Washingtoner Prinzipien und der Gemeinsamen Erklärung steht eine Handreichung zur Verfügung. Sie wird vom Bund, den Ländern und den kommunalen Spitzenverbänden zur Verfügung gestellt und dient als Orientierungshilfe für den Umgang mit NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut. Zwar ist sie rechtlich nicht bindend, ruft Bibliotheken jedoch ausdrücklich dazu auf, ihre Bestände auf NS-Raubgut zu überprüfen.
Leitfaden Provenienzforschung
Der „Leitfaden zur Provenienzforschung für Kulturgut, das während der nationalsozialistischen Herrschaft verfolgungsbedingt entzogen wurde“ dient als Hilfsmittel zur Identifizierung von geraubten Kulturgut. Erarbeitet wurde er vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste gemeinsam mit Museums-, Bibliotheks- und Provenienzforschungsverbänden.
Informatives zum Thema Provenienzforschung
Tag der Provenienzforschung
Der „Tag der Provenienzforschung“ findet einmal im Jahr, immer am zweiten Mittwoch im April statt. Ins Leben gerufen wurde er 2019 durch den Arbeitskreis Provenienzforschung e. V., einem internationalen Netzwerk von Wissenschaftler*innen und Expert*innen. Im Rahmen dieses Tages bieten verschiedene Einrichtungen Vermittlungsangebote und Veranstaltungen rund um das Thema Provenienzforschung an. Diese können sowohl virtuell als auch vor Ort in den beteiligten Museen, Archiven und Bibliotheken etc. stattfinden.
Bibliotheksblogs
Drei Blogs, die sich in verschiedenen Beiträgen mit dem Thema Provenienzforschung befassen:
- Blog der SLUB Dresden: SLUBlog
- Blog der Deutschen Nationalbibliothek
- Blog der Universitätsbibliothek der FU Berlin: BIBLIOBLOG
Podcasts
1. „Spuren in Tausenden Büchern“ Podcast der Arbeitsstelle Provenienzforschung an der Universitätsbibliothek der FU Berlin
2. „Zweites Untergeschoss“ Podcast der SLUB Dresden
Weiterführende Informationen und Literatur
Alker, Stefan; Bauer, Bruno; Stumpf, Markus (2017): NS-Provenienzforschung und Restitution an Bibliotheken. Berlin: De Gruyter Saur
Arbeitskreis Provenienzforschung. https://www.arbeitskreis-provenienzforschung.org/
DNB – Provenienzforschung. https://www.dnb.de/DE/Ueber-uns/Provenienzforschung/provenienzforschung_node.html
FU Berlin – Provenienzforschung. https://www.fu-berlin.de/sites/ub/ueber-uns/provenienzforschung/provenienzforschung/index.html
Jacobs, Stephanie (Hg.) (2022): Tiefenbohrung. Eine andere Provenienzgeschichte. Berlin: Hatje Cantz
NS-Raubgut: Grundlagen und Übersicht. https://kulturgutverluste.de/kontexte/ns-raubgut
Provenienzforschung und Provenienzerschließung. https://www.bibliotheksverband.de/provenienzforschung-und-provenienzerschliessung
Saskia Johann, Annette Müller-Spreitz, Alexander Sachse (2024): Erstcheck Provenienzforschung. Eine Handreichung für die Praxis. https://kulturgutverluste.de/sites/default/files/2024-09/Erstcheck_Provenienzforschung_Handreichung_2024_web.pdf
SLUB – Provenienzforschung. https://www.slub-dresden.de/ueber-uns/provenienzforschung
Von A wie Autopsie bis Z wie zurückgeben. https://blog.dnb.de/von-a-wie-autopsie-bis-z-wie-zurueckgeben/
Was ist Provenienzforschung? https://www.bib.uni-mannheim.de/ihre-ub/projekte-der-ub/verfolgungs-bedingt-entzogenes-kulturgut/provenienzforschung/
Weber, Jürgen (2024): Sammeln nach 1998. Wie Provenienzforschung die Bibliotheken verändert. Bielefeld: transcript Verlag (Phänomenologie der Bibliothek: Redescriptions, Bd. 1). https://doi.org/10.1515/9783839472248
„Zweites Untergeschoss. Ein Forschungspodcast zur Herkunft von Büchern“ der SLUB Dresden startet. https://blog.slub-dresden.de/beitrag/2025/1/27/zweites-untergeschoss-ein-forschungspodcast-zur-herkunft-von-buechern-der-slub-dresden-startet